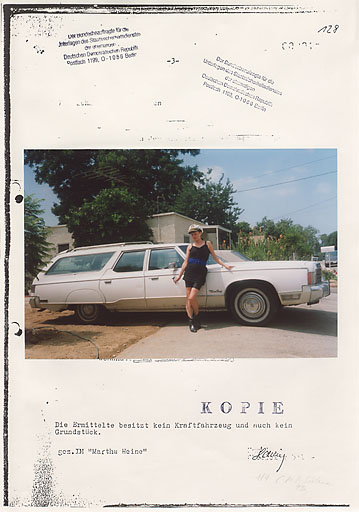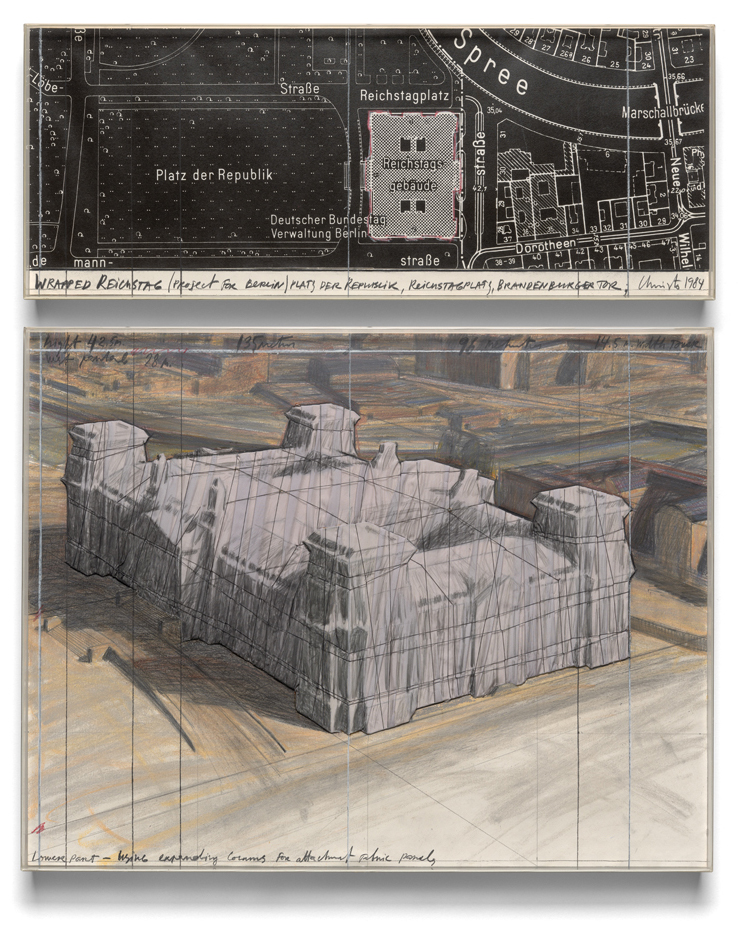„Balkanik“ ist ein traditioneller türkischer Kuchen mit griechischem Einfluss, der heute nur noch selten in Istanbuler Bäckereien zu finden ist. Die Künstlerin Ayse Erkmen präsentierte das Rezept des Kuchens erstmals 2003 während der Ausstellung „IN DEN SCHLUCHTEN DES BALKANS“ in der Kunsthalle Fridericianum, die sich mit der rasant entwickelnden Kunst- und Kulturszene der Länder im Südosten Europas auseinandersetzte. Während der Ausstellung It’s Just a Matter of Time erlebt der Kuchen ein Revival und wird im Café LePopulaire erneut angeboten.

Ayşe Erkmen, "Balkanık2, 2003/2025, Cake project.
Courtesy of the artist / Galerie Trautwein Herleth, Berlin
Interkultureller Transfer und Auslöschung
Dieser Akt der Wiederbelebung eines fast vergessenen Rezepts, verdeutlicht den interkulturellen Transfer und die Auslöschung innerhalb des eurasischen Kulturraums. Mit Schichten aus Biskuit- und Brandteig, Milchcreme, Zitronen- und Erdbeersauce, Schokoladenganache, -glasur und Schlagsahne, Pistaziensplitter oder Kokosraspeln, kandierten Früchten spiegelt Balkanık nicht nur den eurasischen Kulturraum mit seiner Vielheit an Gesellschaftsformen, Sprachen, Bräuchen, und Kulinarik wider, sondern es symbolisiert auch den unaufhaltsamen Fluss gegenseitiger kultureller Einwirkungen und Überschreibungen. Erkmens Werk nutzt eine alltägliche Situation, um herauszuarbeiten, wie unsere soziale Struktur stets transkulturell geformt ist. Die Schichten von Füllungen und Glasuren verdeutlichen, dass Identitäten immer komplizierter sind, als sie zunächst erscheinen.
Der Kuchen symbolisiert den historischen Austausch zwischen griechischer und türkischer Kultur, aber auch das Verschwinden von Traditionen aufgrund von Ereignissen wie dem griechisch-türkischen Bevölkerungsaustausch im frühen 20. Jahrhundert.
Ortsspezifische Bedeutung
Erkmens Wahl des Café LePopulaire im Operncafé ist bedeutsam. Der Ort, der zu DDR-Zeiten ein kosmopolitischer Knotenpunkt war, verkörpert eine ähnliche Geschichte kultureller Schichtung und Transformation und spiegelt die Themen wider, die in „Balkanik“ präsent sind.
Liberty Adrian und Carina Bukuts leiten seit 2022 zusammen die Ausstellungsinstitution Portikus in Frankfurt am Main. Dort kuratierten sie unter anderem Einzelausstellungen zu Julian Irlinger (2025), Adrian Piper (2024) oder Simone Fattal (2023). Schon 2021 arbeiteten sie zusammen für das Projekt Baldade Berlin, einen Ausstellungsparcours durch Berlin. Liberty Adrian ist
Kunsthistorikerin, Kuratorin und Kritikerin. Carina Bukuts arbeitet als Kunsthistorikerin als Kuratorin, Autorin und Redakteurin.